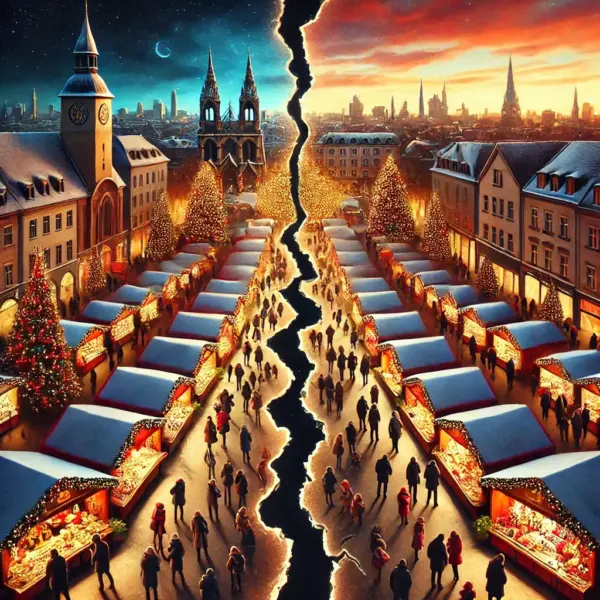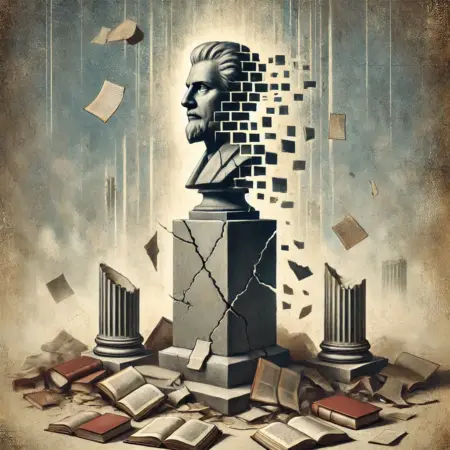Was macht einen Vorfall wie die Magdeburger Todesfahrt so besonders? Ist es der tragische Verlust von Leben? Die unfassbare Brutalität, die einem die Luft abschnürt? Oder ist es die Tatsache, dass wir immer noch keinen Plan haben, wie wir solche Taten einordnen sollen, ohne dabei in ideologischen Reflexen zu versinken? Willkommen in der wunderbaren Welt der gesellschaftlichen Schuldzuweisungen.
Die Täterbiografie als Wundertüt
Ein Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie, ein Araber, ein AfD-Befürworter und ein erklärter Islamkritiker – der Täter dieser unfassbaren Tat bringt so viele widersprüchliche Merkmale mit, dass die Medienlandschaft gar nicht mehr weiß, welche Schublade sie aufziehen soll. Ist er ein rechtsextremer Terrorist? Ein psychisch kranker Einzeltäter? Oder einfach nur ein tragisches Beispiel dafür, dass wir im 21. Jahrhundert keine Ahnung mehr haben, wie wir komplexe Menschen begreifen sollen?
Man könnte meinen, dass eine Gesellschaft, die von „Diversity“ schwärmt, zumindest bei der Analyse von Tätern etwas mehr Vielschichtigkeit ertragen könnte. Aber nein, die Suche nach der einen Wahrheit läuft wie gewohnt auf Hochtouren.
Terror oder nicht Terror?
Und so beginnt das übliche Ritual: Der Täter wird seziert wie ein Stück Fleisch in der Metzgerei. Sein Leben wird durchforstet, seine Facebook-Posts zu Mantras erhoben, und seine politische Orientierung wird zum Symbol für alles, was wir hassen. Aber Vorsicht! Das Wort „Terror“ wird nur mit Samthandschuhen angefasst, als hinge die Stabilität der Republik von seiner korrekten Anwendung ab.
Ein rechtsextremer Araber, der für die AfD wirbt und Islamhasser ist – das passt nicht in die gängigen Muster. Würde er „Allahu Akbar“ rufen, wäre die Sache klar: Islamistischer Terror. Würde er ein Hakenkreuz-Tattoo tragen, könnten wir ihn in die rechtsextreme Ecke schieben. Aber so? So bleibt nur eines: maximale Verwirrung.
Der Elefant im Raum: Psychiatrie
Ach ja, und dann wäre da noch der kleine Fakt, dass der Täter Psychiater war. Man möchte meinen, dass jemand, der sich beruflich mit der menschlichen Psyche beschäftigt, entweder bemerkenswert reflektiert oder beängstigend gut darin ist, seine Abgründe zu verbergen. Dass seine Kollegen und sein Umfeld nichts bemerkt haben wollen, wirft Fragen auf: Hat er in Konferenzen die AfD-Fahne geschwenkt? Hat er zwischen Therapie-Sitzungen anti-islamische Parolen gerufen? Oder waren seine Äußerungen so subtil, dass niemand sie als Warnsignal erkannte?
Die Antwort darauf ist erschreckend einfach: Solange jemand nicht in voller Montur mit einem Aluhut im Büro erscheint, neigen wir dazu, Anzeichen von Radikalisierung zu ignorieren. Schließlich will niemand als hysterischer Denunziant gelten. Lieber lächelt man höflich und geht weiter.
Populistische Schnellschüsse
Natürlich lassen sich die üblichen Verdächtigen eine solche Chance nicht entgehen. Alice Weidel setzt ihre üblichen Tweets ab, Elon Musk ruft zum Sturz der Regierung auf, und Nigel Farage? Der mischt sich aus Großbritannien ein, weil er sonst nichts zu tun hat. Die linke Seite antwortet brav mit einem Shitstorm, der genau nichts verändert. Das Ganze gleicht einem lautstarken Pingpong-Spiel, bei dem niemand daran interessiert ist, den Ball tatsächlich ins Netz zu bringen.
Was wir nicht sehen wollen
Währenddessen geht eine wichtige Frage völlig unter: Warum schaffen wir es nicht, solche Taten frühzeitig zu erkennen? Warum bleiben Menschen wie dieser Täter, die offenbar seit Jahren in einer Spirale aus Wut und Verzweiflung gefangen sind, so lange unsichtbar? Die Antwort liegt vermutlich irgendwo zwischen unserer gesellschaftlichen Blindheit und dem Unwillen, die unbequemen Fragen zu stellen.
Denn seien wir ehrlich: Es ist viel einfacher, die Schuld einer Ideologie, einer Partei oder einer Religion zuzuschieben, als die Strukturen zu hinterfragen, die solche Taten ermöglichen. Wie sichern wir Weihnachtsmärkte? Wie verhindern wir Radikalisierung, egal ob politisch oder religiös? Und vor allem: Wann hören wir endlich auf, uns in reflexhaften Schuldzuweisungen zu verlieren?
Die tragische Pointe
Die Magdeburger Todesfahrt ist ein Albtraum, keine Frage. Aber sie ist auch ein Spiegel, der uns zeigt, wie schlecht wir als Gesellschaft mit komplexen Problemen umgehen können. Statt klare Fragen zu stellen und echte Lösungen zu suchen, schieben wir die Verantwortung hin und her, bis sie irgendwo im Nirgendwo verschwindet. Und so bleibt am Ende nur eines: die traurige Erkenntnis, dass wir aus all den Tragödien der letzten Jahre kaum etwas gelernt haben.
Ob der Täter ein Terrorist, ein Wahnsinniger oder beides war, ist letztlich fast nebensächlich. Die wahre Katastrophe liegt darin, dass wir immer noch nicht wissen, wie wir mit solchen Taten umgehen sollen – weder als Gesellschaft noch als Individuen. Magdeburg hat Besseres verdient. Und wir auch.